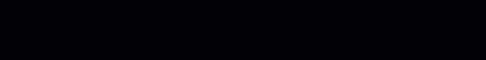Nils Dünninger ist erst 24 Jahre jung, aber schon fast zehn Jahre fester Bestandteil der bayerischen Schiedsrichter-Szene. Seit vergangenem Jahr ist Dünninger, der auch im Juniorteam aktiv ist, internationaler Schiedsrichter. Der Masterstudent im Chemieingenieurwesen spricht im BTTV-Talk über seinen Einsatz bei den Jugend-Europameisterschaften in Ostrava, über geteilte Bäder, kuriose Vorfälle, spannende Begegnungen und seine Motivation für ehrenamtliches Engagement.
Nils, du warst im Juli zehn Tage bei der Jugend-EM in Ostrava und befindest dich mitten in deiner Masterarbeit. Wie hat sich das mit dem Einsatz vereinbaren lassen?
Nils Dünninger: Das war tatsächlich gar nicht so einfach, aber ich habe es früh genug geplant und mit meinem Betreuer abgestimmt. Dann war das kein Problem.
Zehn Tage – das ist schon besonders lang für ein Turnier, oder?
Dünninger: Auf jeden Fall. Das ist eines der wenigen Turniere, die wirklich über zwei Wochen gehen. Normalerweise ist man international nur eine Woche unterwegs.
„Vier Leute, ein Bad – das ist dann schon eher die rustikale Variante“
Wie war es für dich vor Ort?
Dünninger: Unsere Unterkunft war eine Art Studentenwohnheim, manche Zimmer waren großzügig ausgestattet wie ein Hotelzimmer. Andere – wie unseres – eher spartanisch. Wir hatten zwei Doppelzimmer mit einem gemeinsamen Bad in einem Vorraum. Das heißt: vier Leute, eine Dusche, eine Toilette. Doppelzimmer ist international der Standard, aber ein Bad für vier Leute ist schon eher die rustikale Variante.
Mit wem hast du dir das Zimmer geteilt?
Dünninger: Mit Eduards aus Lettland. Den kannte ich schon vom letzten Jahr. Wir sind ähnlich alt und haben uns gut verstanden. Ich denke, wir haben es beide relativ gut erwischt (lacht).
Kann man Wünsche äußern?
Dünninger: Manchmal. Bei meinem ersten internationalen Turnier hatte ich mich mit Simon Eiler aus Bayern abgestimmt, da haben wir dem Einsatzleiter geschrieben. Das hat funktioniert. Sonst habe ich mich einfach überraschen lassen. Es gab aber noch keinen Fall, wo man sich untereinander nicht verstanden hat.
Wie lief so ein typischer Einsatztag für dich bei der EM ab?
Dünninger: Bei der Jugend-EM gibt es ja mittendrin diesen Bruch zwischen Mannschaft und Einzel. Es hängt von den Wettbewerben ab. Bei den Team-Wettkämpfen muss man eine Stunde vor Spielbeginn da sein, macht die Schlägerkontrolle, nimmt die Auslosung mit den Trainern vor, lässt Bälle auswählen. Dann kann es im Teamwettbewerb mal locker über drei Stunden gehen ohne Pause. Es passiert zum Beispiel, dass du zwischen 10 und 16 Uhr nonstop für zwei Teammatches im Einsatz bist. Dann ist der Tag auch vorbei. Es kann aber auch umgekehrt sein mit einem Einsatz von 8 bis 11 und dann erst ab 15 Uhr. Insgesamt ist die Einsatzzeit beim Teamwettbewerb kompakter, aber auch intensiver.
Und in den Einzel-Wettbewerben?
Dünninger: Da muss man eine halbe Stunde vorher in der sogenannten Call-Area sein und man hat zwischen den Matches kleinere Pausen.
Wie sieht die Abendgestaltung aus?
Dünninger: Das war schon ganz schön. Wir waren immer einige Schiedsrichter, die sich abends zusammengesetzt haben und über den Tag geredet, aber auch Geschichten, die man selbst erlebt hat, erzählt haben.
Ist es Usus, dass man gemeinsam den Tag Revue passieren lässt?
Dünninger: Markus Baisch (langjähriger internationaler Oberschiedsrichter des DTTB) hat mal zu mir gesagt: Man ist 12 Stunden in der Halle, es geht nur um Tischtennis. Dann setzt man sich am Abend bei einem kühlen Getränk mit anderen Schiedsrichtern zusammen und redet – fast nur über Tischtennis, als ob man nicht schon genug hätte. Und so ist es wirklich.
Wie war es in Ostrava?
Dünninger: Wir haben über Entscheidungen des Tages diskutiert, zum Beispiel wenn mal etwas komplett Abgefahrenes passiert ist. In Ostrava gab es schon einige „interessante“ Szenen. Da kamen über die Tage einige Geschichten und gelbe Karten zusammen.
Was gab es für Situationen?
Dünninger: Ein Trainer hat bei mir und meiner Kollegin eine Verschwörung gegen seine Mannschaft gewittert, nachdem wir Aufschläge weggezählt hatten, und seinen Unmut nicht unbedingt auf die freundlichste Art geäußert. Wir haben dann versucht, die Situation zu beruhigen, aber sowas beschäftigt einen dann doch noch ein bisschen.
Gibt es rund um die Aufschläge die meisten Diskussionen?
Dünninger: Es hängt natürlich zum Großteil an den Protagonisten am Tisch. Generell kommt beim Aufschlag viel zusammen. Angefangen von der Position der Hand beim Ballwurf, die Handhaltung, Sichtbarkeit, Abwurfwinkel, Höhe, verdeckt oder nicht … Als Schiedsrichter stecken wir etwas im Zwiespalt: Wir wollen das Spiel nicht kaputtmachen, aber es muss schon regelkonform laufen und fair zugehen. Manchmal verschafft sich ein Spieler auch keinen Vorteil, aber es ist trotzdem klar gegen die Regel. Natürlich sind da immer viele Emotionen dabei. Aber man lernt damit umzugehen und solche Situationen zu deeskalieren oder zu verhindern.
Gab es auch konkrete Situationen in Ostrava?
Dünninger: Ja, wir hatten eine sehr junge Spielerin, die mit dem Ball in der Hand über dem Tisch aufgeschlagen hat. Sie verstand scheinbar kein Englisch, was es schwermachte, es ihr zu erklären. Sie hat zwar stets genickt, wenn wir es ihr auch durch Zeichen versucht haben zu erklären, was das Problem ist, aber nach dem zweiten Fehlaufschlag sah sie verzweifelt aus, als ob sie nicht wüsste, was sie falsch macht. Wir haben dann den Trainer darauf aufmerksam gemacht, es seiner Spielerin zu erklären, wonach es dann auch besser wurde.
Auf der anderen Seite gab es auch einen Spieler, der – noch bevor wir die Begründung für die Ermahnung seines Aufschlages sagen konnten – sich umgedreht hat und sagte „Schulter im Weg?“. Anschließend schlug er das restliche Match korrekt auf. Man wird also auch manchmal etwas ausgetestet.
"Man braucht schon ein gewisses Maß an Selbstsicherheit und Stressresistenz"
Was ist das Schwierige an der Aufschlagregel?
Dünninger: In meinen Augen ist es der Ballwurf. Wie vertikal ist er, stimmt die Höhe, der Winkel, wann verlässt der Ball wirklich die Hand? Das ist oft schwer zu erkennen, wenn die Hand nach dem Abwurf dem Ball noch leicht folgt oder der Ball lange geführt wird, ohne die Hand zu verlassen.
Die ITTF/WTT haben ja schon den Videobeweis getestet, was hältst du davon?
Dünninger: An sich ist das eine gute Sache, die Diskussionen, dass der abgezählte Aufschlag doch eigentlich richtig war, kann abgekürzt werden, indem der Spieler sieht, dass der Aufschlag objektiv falsch war oder die Entscheidung im Zweifel doch überstimmt wird. Auf der anderen Seite muss man sehen, ob die Challenge nicht zu sehr auch als taktisches Mittel eingesetzt wird, um den Gegner aus dem Spielfluss zu bringen. Insgesamt wird die Zukunft zeigen, wie es sich etabliert und von den Spielern angenommen wird.
Du bist 24 und hast schon vor knapp zehn Jahren mit der Ausbildung begonnen. Wie kam das eigentlich?
Dünninger: Ich fand das Thema Schiedsrichter immer spannend. In der Schule war ich der Einzige, der neben den Fußballstars auch mal einen Schiedsrichter genannt hat. Mich hat das auch unabhängig von der Sportart interessiert. Zum Beispiel schaue ich auch gerne beim Eishockey, wie die Schiedsrichter kommunizieren und auftreten. Wir haben im Tischtennis zwar weniger direkte Kommunikation mit den Spielern im Spiel, aber im Prinzip geht es um dieselbe Sache.
Auslöser für meine Anmeldung am Neulingslehrgang war dann ein Flyer dazu, den ich bei einem Bundesliga-Spiel gesehen habe. Ich habe mich dann angemeldet und kurz vor meinem 15. Geburtstag den damaligen Kreisschiedsrichter gemacht, danach direkt den Bezirksschiedsrichter. 2016 war mein erster Einsatz, gleich in der Vorrunde um den DTTB-Pokal in Bad Königshofen.
Und seit letztem Jahr bist du sogar internationaler Schiedsrichter.
Dünninger: Das Level der nationalen Schiedsrichter in Deutschland ist schon sehr hoch, dadurch hat man eine gute Ausgangsposition. Natürlich braucht es aber davor auch nochmals Vorbereitung. Die Prüfung zur ersten Stufe als internationaler Schiedsrichter, dem sogenannten White Badge, habe ich im Rahmen der EM 2024 in Linz abgelegt.
Willst du noch weiter gehen?
Dünninger: Als nächsten Schritt möchte ich den Blue Badge, also die nächste Stufe international am Tisch, in Angriff nehmen. Das wird aber kein Selbstläufer, da der Anspruch nochmal ein Stück höher ist und noch mehr auf das Auftreten im Spiel geachtet. Der Gold Badge Status, also die höchste Schiedsrichterstufe, wäre langfristig schon ein Traum, die einem nochmal mehr Türen öffnet. Aber das ist ein langer Weg. Man muss konstant herausragende Leistungen zeigen, regelmäßig evaluiert werden und viel Zeit investieren. Wie das mit Beruf und Familie mal vereinbar ist, muss man dann sehen. Aber die Motivation ist da. Als „Young Umpire“ bin ich aktuell in einem europaweiten Programm, das die Teilnehmenden besonders fördert und mich bereits interessante Erfahrungen hat sammeln lassen. Vielleicht ergibt sich so etwas auch mal auf weltweiter Ebene.
Was für eine Aufwandsentschädigung erhältst du bei einer EM zum Beispiel?
Dünninger: Das hängt von der Qualifikation ab. Ein nationaler Schiedsrichter erhielt 35 Euro pro Tag. Als White Badge bekam man 45 pro Tag, während Blue oder Gold Badge mit 50 Euro entlohnt werden. Verpflegung und Unterkunft werden international immer gestellt, An- und Abreise sind selbst zu tragen. Am Jahresende gibt es zu diesen Kosten aber einen anteiligen Zuschuss vom DTTB.
Welche Eigenschaften sollte man als Schiedsrichter vielleicht mitbringen?
Dünninger: Man braucht schon ein gewisses Maß an Selbstsicherheit und Stressresistenz. Man muss in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen und dazu stehen, gerade in kniffligen Situationen. Und natürlich Kommunikationsfähigkeit. Man sollte auf Augenhöhe agieren, nicht als „Chef“. Mit der Zeit wächst man da rein – auch was Körpersprache und Auftreten betrifft.
Wie gehst du mit Konflikten um?
Dünninger: Es ist sicher situationsabhängig und man braucht ein bisschen Gespür. Wo ist der Konflikt, wie kann man vermitteln? Ich hatte mal eine schöne Erfahrung bei den Unterfränkischen Meisterschaften Schüler C. Da hat sich ein Junge recht aufgebracht beschwert, dass der Gegner falsch aufschlägt. Als Oberschiedsrichter habe ich beide zusammengeholt und wir haben kurz gesprochen, die Emotionen etwas runterfahren lassen. Am Ende kamen noch mal beide auf mich zu und haben sich bedankt, da das Spiel dann ruhig weiterging.
Inwieweit hat dich dein Schiedsrichter-Engagement auch persönlich weitergebracht?
Dünninger: Ich weiß natürlich nicht, wie ich mich ohne entwickelt hätte, aber ich denke schon. Man sammelt viele Erfahrungen, lernt auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, reflektiert seine Entscheidungen und Situationen, reist ins Ausland, kommt mit Menschen aus aller Welt in Kontakt. Man bekommt andere Perspektiven – und trägt dazu bei, dass der Sport fair abläuft. Am 14. September startet wieder ein Neulingslehrgang in Bayern. Mittlerweile spielt sich in der Ausbildung auch schon viel online ab (Infos gibt es hier).
Du bist auch im BTTV-Junior-Team aktiv. Was ist deine Motivation?
Dünninger: Mir ist wichtig, dass junge Menschen einen unkomplizierten Einstieg ins Ehrenamt finden – ohne gleich ein Amt übernehmen zu müssen. Das Junior-Team bietet eine Plattform, sich auszuprobieren, Ideen einzubringen, etwas anzupacken. Aktionen wie „MischMiTT“ oder das Juniorteam zeigen, dass sowas funktioniert. Einige engagieren sich heute in Gremien oder Vereinen oder kriegen zumindest ein Gespür für ehrenamtliches Arbeiten – das ist richtig schön zu sehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Nils!